|
|
Die "Alte Kirche zu Krefeld"
Die ältesten Kirche von Krefeld liegt im Zentrum
der mittelalterlichen Stadt. Von dieser Stadt ist heute im Straßenbild nicht mehr
viel übriggeblieben.
Vorwort:

 eute, am 17. September
2011 hat Archäologie in Krefeld eine
Entdeckung an der Alten Kirche gemacht. Durch Zerfall der Außenbeschichtung
wurde ein Teil des aufgehenden Mauerwerks freigelegt.
Sichtbar wurden römische Ziegel, die mit verbaut worden waren. eute, am 17. September
2011 hat Archäologie in Krefeld eine
Entdeckung an der Alten Kirche gemacht. Durch Zerfall der Außenbeschichtung
wurde ein Teil des aufgehenden Mauerwerks freigelegt.
Sichtbar wurden römische Ziegel, die mit verbaut worden waren.
Das gab Anlass sich mit der ältesten Kirche von Krefeld zu
beschäftigen und ihr eine eigene Seite zu widmen(1).
Kurzübersicht
ALTE KIRCHE
|
1166 |
Ältester urkundlich
erwähnter Sakralbau in Krefeld. (Dionysiuskapelle) |
|
1472 |
Bau einer spätgotischen
Dreischiffigen Kirche |
|
ab 1560 |
Graf Hermann von Moers
Führt in seiner Grafschaft das Augsburger Bekenntnis ein
(Reformierte Kirche). |
|
1584 |
Krefeld brennt ab, die
Kirche wird in Mitleidenschaft gezogen Erneuerung der Kirche, |
|
ab 1599 |
kann
wieder Gottesdienst gehalten werden. |
|
1607 |
Evangelisch-
Reformierte Kirche |
|
1747 |
Inschriftentafeln
entstehen - in der Nordwand der Kirche Eingelassen. |
|
1840-42 |
Neubau einer
gotisierenden Hallenkirche, die an den Alten Turm angebaut wird.
Architekt: Johann Heinrich Freyse |
|
22.06.1943 |
Das Kirchenschiff wird
durch Bombenangriff zerstört |
|
14.04.1951 |
Einsturz des gotischen
Turmes |
|
14.12.1952 |
Einweihung der wieder
aufgebauten Alten Kirche Architekt: Paul A. Kessler |
|
1965 |
Ein neuer Turm wird
errichtet |
|
2003 |
Indienstnahme der
Vleugels-Orgel
Prof. Ewald Mataré schuf beide Eingangsportale. Das
Kreuz an der nördlichen Außenwand stammt von Prof. Ackermann,
Ebenso die anbetende Gemeinde und die Tauftafel im Innenraum der
Kirche. |
|
Quelle:
Förderverein "Alte Kirche - Aktive Kirche e. V. " |
Folgen wir kurz den Erläuterungen von Albert Steeger
in seinem Bericht mit dem Titel:
"Die Alte Kirche zu Krefeld im Wechsel der Jahrhunderte"
"Ein tragisches Geschehen nahm unserer Stadt das Wahrzeichen und
damit ihr ältestes Bauwerk; denn die Geschichte der Krefelder
Kirche reicht mit 800 Jahren
zurück in die Blütezeit des Reiches, da der
Staufer Friedrich Barbarossa
den deutschen Kaiserthron zierte". Von der
romanischen Kirche dieser Zeit stand aber schon
seit Jahrhunderten kein Stein mehr über der Erde, ja wir wußten
bis vor kurzem nicht einmal, wo sie gestanden hatte. Und nun ist
mit dem Turm auch der letzte Rest der
spätgotischen Kirche, die wenige Jahrzehnte vor der
Reformation erbaut wurde, restlos vom Erdboden verschwunden. Wir
können bei unseren Nachkommen nur die Erinnerung an diese
Bauwerke, die Ursprung und Mittelpunkt des alten Krefeld
waren, durch Wort und Bild wach halten. So werden sie verstehen,
warum das neue Bauwerk noch immer "Alte
Kirche" heißt.
-
1
Stadtansichten der Alten Kirche
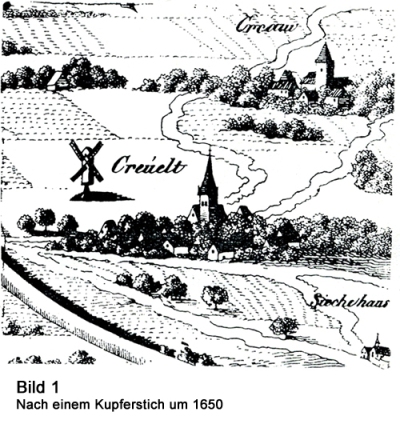
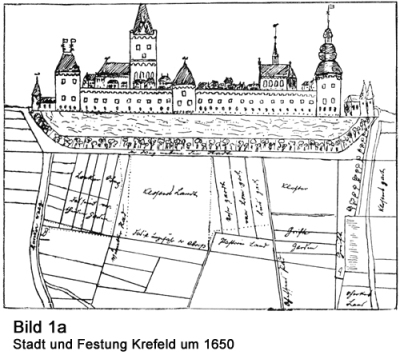
Der
älteste Lageplan der Stadt Krefeld
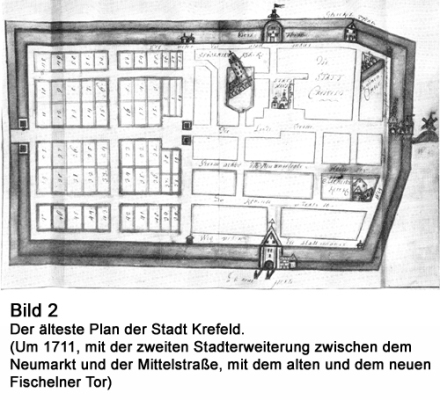
 er
14. Dezember 1952
war ein denkwürdiger Tag. Die Alte Kirche
von Krefeld wurde eingeweiht. Die Kirche wurde durch Brandbomben in der
Nacht zum 22. Juni 1943 zerstört.
Trotz Sicherheitsmaßnahmen stürzte der spätgotische Turm während der
Wiederaufbaumaßnahme ein. Ein neuer Turm wurde südlich neben dem
Langhaus neu errichtet (Bild
12). Der bekannte Heimatforscher Albert
Steeger (1885-1958) konnte
im innern der Kirche Ausgrabungen durchführen, die wichtige Fragen zur
Baugeschichte der Kirche beantworten konnten. Welche bildlichen
Nachrichten gibt es? er
14. Dezember 1952
war ein denkwürdiger Tag. Die Alte Kirche
von Krefeld wurde eingeweiht. Die Kirche wurde durch Brandbomben in der
Nacht zum 22. Juni 1943 zerstört.
Trotz Sicherheitsmaßnahmen stürzte der spätgotische Turm während der
Wiederaufbaumaßnahme ein. Ein neuer Turm wurde südlich neben dem
Langhaus neu errichtet (Bild
12). Der bekannte Heimatforscher Albert
Steeger (1885-1958) konnte
im innern der Kirche Ausgrabungen durchführen, die wichtige Fragen zur
Baugeschichte der Kirche beantworten konnten. Welche bildlichen
Nachrichten gibt es?
Krefeld war vor 300 Jahren
noch ein unbedeutendes Landstädtchen
(Bild 1). Es hatte zwar eine Festung, umgeben
von Wall, Graben, Mauer, Türmen und Tore, hat aber aufgrund neuerer
Feuerwaffen keine bastionsförmigen Anlagen erhalten. Daher gibt es auch
nur wenige bildliche Darstellungen von Gebäuden.
 Eine Handskizze aus der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
zeigt die spätgotische Kirche von Osten aus gesehen. Rechts neben der
Alten Kirche befindet sich das
St. Johann Baptistkloster an der
Poststraße gelegen (Bild 1a).
Als nächst jüngeres Dokument sehen Sie einen Grundrissplan der Stadt
Krefeld. Er stammt aus der zweiten Stadterweiterung um
1711. Das Fischelner Tor stand am
heutigen Neumarkt. Im Pflaster ist der Torgrundriss aufgezeichnet.
Die "Reformirte Kerck" zwischen
"Menisten Kercke",
"Kloster",
"Statthaus", "Evers Tornn"
und "Begynen Kloster" sind stark
schematisch dargestellt worden. Deutlich erkennen wir die beiden Zugänge
zum Kirchplatz. Der eine vom Schwanenmarkt der andere von der
Hochstraße. Hier so vermutete Steeger waren sogenannte " Pfarreisen"
im Boden angebracht. Diese Eisenroste befanden sich im Boden zu den
Eingängen zum Friedhof. Eine mittelalterlichen Kirchenvorschrift
besagte, dass an allen Toren und Eingängen zum Friedhof weitmaschige
Roste an zu bringen sind, um das Vieh den Zutritt zu verwähren
(Bild 2). Eine Handskizze aus der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
zeigt die spätgotische Kirche von Osten aus gesehen. Rechts neben der
Alten Kirche befindet sich das
St. Johann Baptistkloster an der
Poststraße gelegen (Bild 1a).
Als nächst jüngeres Dokument sehen Sie einen Grundrissplan der Stadt
Krefeld. Er stammt aus der zweiten Stadterweiterung um
1711. Das Fischelner Tor stand am
heutigen Neumarkt. Im Pflaster ist der Torgrundriss aufgezeichnet.
Die "Reformirte Kerck" zwischen
"Menisten Kercke",
"Kloster",
"Statthaus", "Evers Tornn"
und "Begynen Kloster" sind stark
schematisch dargestellt worden. Deutlich erkennen wir die beiden Zugänge
zum Kirchplatz. Der eine vom Schwanenmarkt der andere von der
Hochstraße. Hier so vermutete Steeger waren sogenannte " Pfarreisen"
im Boden angebracht. Diese Eisenroste befanden sich im Boden zu den
Eingängen zum Friedhof. Eine mittelalterlichen Kirchenvorschrift
besagte, dass an allen Toren und Eingängen zum Friedhof weitmaschige
Roste an zu bringen sind, um das Vieh den Zutritt zu verwähren
(Bild 2).

-
2
Lage der gotischen Kirche
Auf diesem Bild noch
gut zu erkennen die mittelalterliche Bebauung der Stadt Krefeld.
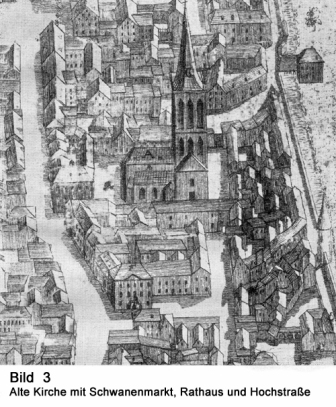
Im Vordergrund der
Schwanenmarkt, im Hintergrund die Alte Kirche um 1850
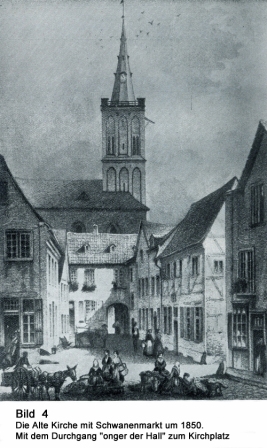
 as
dreidimensional vergrößerte Bildausschnitt ist Teil einer Gesamtansicht
der Stadt Krefeld und stammt von D. Braches und
wurde Conrad Friedrich und Johann von
der Leyen gewidmet
(Bild 3). Es wurde am Ende des 18.
Jahrhunderts
in Auftrag gegebenen und zeigt die Alte Kirche
im damaligen Stadtbild. Durch einen Tordurchgang vom Schwanenmarkt
aus, gelangte man zum Kirchhof. Es gab auch einen Zugang vom
Bröcksken aus über die Quartelnstraße zur Kirche. Beide Tore
waren verschlossen. as
dreidimensional vergrößerte Bildausschnitt ist Teil einer Gesamtansicht
der Stadt Krefeld und stammt von D. Braches und
wurde Conrad Friedrich und Johann von
der Leyen gewidmet
(Bild 3). Es wurde am Ende des 18.
Jahrhunderts
in Auftrag gegebenen und zeigt die Alte Kirche
im damaligen Stadtbild. Durch einen Tordurchgang vom Schwanenmarkt
aus, gelangte man zum Kirchhof. Es gab auch einen Zugang vom
Bröcksken aus über die Quartelnstraße zur Kirche. Beide Tore
waren verschlossen.
Der Kirchbau in
(Bild 3 u. 4)
stellt eine dreischiffige Anlage mit zwei gesonderten Turmhallen dar. In
der Kunstgeschichte wird so ein Bau "Pseudobasilika" genannt. Nach
Albert Steeger handelt es sich vom Gesamtaufbau her um die
alte gotische
Kirche
von 1472.
 egen
baulicher Mängel wurde nach mündlicher Überlieferung um
1842
das
Langhaus und die beiden Seitenschiffe abgebrochen. Der Turm blieb
stehen. Dann baute man ein neues Langhaus in Form einer
Hallenkirche mit großen Fenstern
(Bild 4). Die
gotische Turmkapelle
wurde erhöht. Das Mittelschiff und die Turmkapellen erhielten ein
gemeinsames Dach. egen
baulicher Mängel wurde nach mündlicher Überlieferung um
1842
das
Langhaus und die beiden Seitenschiffe abgebrochen. Der Turm blieb
stehen. Dann baute man ein neues Langhaus in Form einer
Hallenkirche mit großen Fenstern
(Bild 4). Die
gotische Turmkapelle
wurde erhöht. Das Mittelschiff und die Turmkapellen erhielten ein
gemeinsames Dach.

-
3
Ausgrabungen in der Alten Kirche durch Albert Steeger
Albert Steeger:
"Saxa loquuntur, d. h. die
Steine Reden, ist ein in der kirchlichen Altertumswissenschaft öfters
gebrauchtes Wort, das in Anlehnung an ein Wort des neuen Testamentes
geprägt ist. Hier will es sagen: Wenn die Bilder Schweigen reden die
Steine des Bauwerkes".
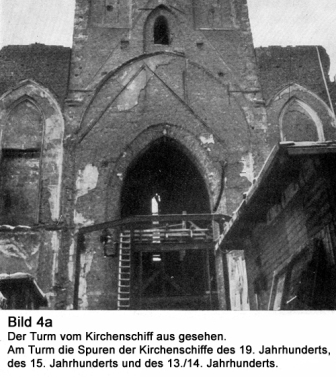
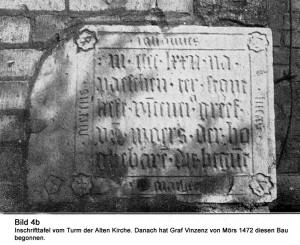
Bild 4b
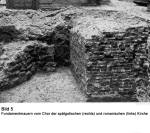
Bild
5

Bild
7
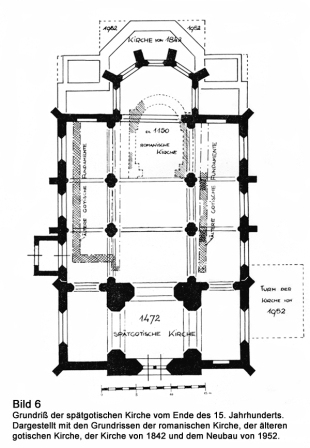
 olgende
Frage stellte sich Albert Steeger
1951: olgende
Frage stellte sich Albert Steeger
1951:
"Lag die romanische Kirche der
Stauferzeit, die in einer
Urkunde von 1166
genant ist, bereits an dieser Stelle oder ist sie anderswo im Stadtkern
zu suchen?"
Durch die starken Zerstörungen der Kirche
wurden in der Innenseite des Turms drei Dachfurchen im Putz sichtbar.
Die Höhere gehörte zur Kirche von
1842, die Tiefere zur
spätgotischen
von 1472.
Eine Dritte war in der Mittelachse nach Süden hin verschoben.
Albert Steeger schloss daraus, das es noch eine Ältere Kirche
gegeben müsse
(Bild 4a).
Eine archäologische Ausgrabung konnte diese Frage nur beantworten.
Nachfolgende Ausgrabungsbefunde werden
unverändert bzw. ungekürzt wiedergegeben
 n
der Baugrube des neuen Heizungskellers wurden primitive Fundamente aus
Naturstein mit einem lockeren Kalkmörtel angeschnitten. Als wir sie
sorgfältig freilegten, erwiesen sie sich als Reste der Rundung einer
Choranlage
(Bild 6 u.7). Eine später
eingebaute Grabkammer hatte zwar das Mittelstück zerstört, aber
glücklicherweise waren die einspringenden Ecken der
Apsis gerade
noch erhalten geblieben, so dass eine Rekonstruktion des ganzen
Chorrunds möglich war
(Bild 6). An dieses setzte
sich aus gleichem Material auf der Südseite eine Längsmauer fort; auf
der Nordseite war eine solche bis auf einen geringen Rest durch spätere
Bestattungen zerstört. Von Seitenschiffen fand sich keine Spur.
Schließlich gelang es, die Südwestecke des Bauwerks festzulegen, so dass
der ganze Grundriss dieser ältesten Anlage gegeben war. Die geringe
Größe der Kapelle mit 4 x 5 m zeugte schon für ein hohes Alter.
Wenige keramische Fundstücke in den Baugruben konnten
um 1200
datiert werden. Das Mauerwerk der Fundamente war das übliche
Gussmauerwerk dieser Zeit, das aus
römischem
Baumaterial in zweiter Verwendung bestand: Tuffsteine,
Liedberger Sandsteine, Rheinkiesel, römischer Estrichboden
und römische Dachziegel. So spricht alles dafür, dass wir in den
Fundamenten dieser Kapelle die
romanische Kirche, die
1166
erstmalig urkundlich erwähnt wurde, angetroffen haben. n
der Baugrube des neuen Heizungskellers wurden primitive Fundamente aus
Naturstein mit einem lockeren Kalkmörtel angeschnitten. Als wir sie
sorgfältig freilegten, erwiesen sie sich als Reste der Rundung einer
Choranlage
(Bild 6 u.7). Eine später
eingebaute Grabkammer hatte zwar das Mittelstück zerstört, aber
glücklicherweise waren die einspringenden Ecken der
Apsis gerade
noch erhalten geblieben, so dass eine Rekonstruktion des ganzen
Chorrunds möglich war
(Bild 6). An dieses setzte
sich aus gleichem Material auf der Südseite eine Längsmauer fort; auf
der Nordseite war eine solche bis auf einen geringen Rest durch spätere
Bestattungen zerstört. Von Seitenschiffen fand sich keine Spur.
Schließlich gelang es, die Südwestecke des Bauwerks festzulegen, so dass
der ganze Grundriss dieser ältesten Anlage gegeben war. Die geringe
Größe der Kapelle mit 4 x 5 m zeugte schon für ein hohes Alter.
Wenige keramische Fundstücke in den Baugruben konnten
um 1200
datiert werden. Das Mauerwerk der Fundamente war das übliche
Gussmauerwerk dieser Zeit, das aus
römischem
Baumaterial in zweiter Verwendung bestand: Tuffsteine,
Liedberger Sandsteine, Rheinkiesel, römischer Estrichboden
und römische Dachziegel. So spricht alles dafür, dass wir in den
Fundamenten dieser Kapelle die
romanische Kirche, die
1166
erstmalig urkundlich erwähnt wurde, angetroffen haben.
-
Die ältere gotische Kapelle
 nsere
zuerst gehegte Vermutung, dass die
romanische Kapelle
sich bis zum Turm erstreckte, hatte sich nicht bestätigt, und jene
älteste Dachspur am Turm würde uns unverständlich geblieben sein, wenn
wir nicht, zu unserer größten Überraschung, eine weitere Kirche
angetroffen hätten, die der bekannten
spätgotischen Kirche
voranging
(Bild 6). Wir bezeichnen sie
nur mit Vorbehalt als frühe
oder ältere gotische Kirche. Sie
ist zwar zeitlich zwischen der
romanischen Kapelle von 1166 und
der Kirche von 1472
anzusetzen, aber eine genaue Datierung ist nicht möglich. Das
Baumaterial besteht teils aus Tuff mit römischen Siegelstücken,
teils aus Ziegelsteinen. Es war schon eine verhältnismäßig großer Kirche
mit Seitenschiffen und zwei recheckigen Pfeilerpaaren, die sich auf der
Südseite noch nachweisen ließen
(Bild 6). Der westliche
Abschluss dieser Kirche war nicht zu klären, weil die weit ausgreifenden
Baugruben der spätgotischen
Turmpfeiler und Grabgruben hier
alles zerstört hatten. Doch scheint sich nach dem Grabungsbefund das
Mittelschiff - vielleicht als Turm- noch weiter nach Westen fortgesetzt
zu haben. Die Fundamentbänke des Mittelschiffes, als Träger der
Rechteckpfeiler, passten ausgezeichnet zu der Spannweite der oben
erwähnten ältesten Dachspur am Turm von
1472.
Man hat dieses, wenn auch nur für kurze Zeit, noch mit dem alten
Mittelschiff verbunden. Als
Apsis benutzte diese frühe,
gotische Kirche
zunächst noch die Apsis
der romanischen Kapelle.
Nicht nachweisbar war die südliche Außenwand dieser Kirche, wohl weil
sie genau im Bereich der noch stehenden heutigen Außenmauer lag, wo wir
nicht graben konnten. Einzelne Schnitte bestärken uns in der Meinung,
dass sie wohl 1842
beseitigt wurde. nsere
zuerst gehegte Vermutung, dass die
romanische Kapelle
sich bis zum Turm erstreckte, hatte sich nicht bestätigt, und jene
älteste Dachspur am Turm würde uns unverständlich geblieben sein, wenn
wir nicht, zu unserer größten Überraschung, eine weitere Kirche
angetroffen hätten, die der bekannten
spätgotischen Kirche
voranging
(Bild 6). Wir bezeichnen sie
nur mit Vorbehalt als frühe
oder ältere gotische Kirche. Sie
ist zwar zeitlich zwischen der
romanischen Kapelle von 1166 und
der Kirche von 1472
anzusetzen, aber eine genaue Datierung ist nicht möglich. Das
Baumaterial besteht teils aus Tuff mit römischen Siegelstücken,
teils aus Ziegelsteinen. Es war schon eine verhältnismäßig großer Kirche
mit Seitenschiffen und zwei recheckigen Pfeilerpaaren, die sich auf der
Südseite noch nachweisen ließen
(Bild 6). Der westliche
Abschluss dieser Kirche war nicht zu klären, weil die weit ausgreifenden
Baugruben der spätgotischen
Turmpfeiler und Grabgruben hier
alles zerstört hatten. Doch scheint sich nach dem Grabungsbefund das
Mittelschiff - vielleicht als Turm- noch weiter nach Westen fortgesetzt
zu haben. Die Fundamentbänke des Mittelschiffes, als Träger der
Rechteckpfeiler, passten ausgezeichnet zu der Spannweite der oben
erwähnten ältesten Dachspur am Turm von
1472.
Man hat dieses, wenn auch nur für kurze Zeit, noch mit dem alten
Mittelschiff verbunden. Als
Apsis benutzte diese frühe,
gotische Kirche
zunächst noch die Apsis
der romanischen Kapelle.
Nicht nachweisbar war die südliche Außenwand dieser Kirche, wohl weil
sie genau im Bereich der noch stehenden heutigen Außenmauer lag, wo wir
nicht graben konnten. Einzelne Schnitte bestärken uns in der Meinung,
dass sie wohl 1842
beseitigt wurde.
 om
aufgehenden Mauerwerk der spätgotischen Kirche stand nach
1840
nur noch der Turm. Unsere Ausgrabung legte von dieser Kirche die
Fundamente der Choranlage mit fünf Seiten eines Achtecks und zwei
schweren Strebpfeilern sowie die Mittelschiffpfeiler frei
(Bild 7). Unter dem
Chorfundament, genau in der Mittellinie der Kirche betrachten. Der
Nachweis der spätgotischen
Pfeiler wurde erleichtert, weil
man beim Bau der Kirche von
1842 den
gotischen
Fußboden mit dem Bauschutt des abgebrochenen
spätgotischen Langschiffes
um 60 cm erhöhte und die Pfeilerstümpfe so hoch stehen ließ. Von
den viere Pfeilern konnten noch drei ermittelt werden, ebenso von den
Halbpfeilern am Turm und am Chorbeginn je einer, so dass eine
vollständige Rekonstruktion des Grundrisses möglich wurde
(Bild 6). Von den
spätgotischen Seitenschiffwänden
waren 1840
nur wenige Zentimeter schmale Streifen im Anschluss an die Turmhallen
erhalten geblieben. Der Chorschluss der
spätgotischen Seitenschiffe
war gerade. Er nutzte die Grundmauern der älteren
gotischen Kirche. om
aufgehenden Mauerwerk der spätgotischen Kirche stand nach
1840
nur noch der Turm. Unsere Ausgrabung legte von dieser Kirche die
Fundamente der Choranlage mit fünf Seiten eines Achtecks und zwei
schweren Strebpfeilern sowie die Mittelschiffpfeiler frei
(Bild 7). Unter dem
Chorfundament, genau in der Mittellinie der Kirche betrachten. Der
Nachweis der spätgotischen
Pfeiler wurde erleichtert, weil
man beim Bau der Kirche von
1842 den
gotischen
Fußboden mit dem Bauschutt des abgebrochenen
spätgotischen Langschiffes
um 60 cm erhöhte und die Pfeilerstümpfe so hoch stehen ließ. Von
den viere Pfeilern konnten noch drei ermittelt werden, ebenso von den
Halbpfeilern am Turm und am Chorbeginn je einer, so dass eine
vollständige Rekonstruktion des Grundrisses möglich wurde
(Bild 6). Von den
spätgotischen Seitenschiffwänden
waren 1840
nur wenige Zentimeter schmale Streifen im Anschluss an die Turmhallen
erhalten geblieben. Der Chorschluss der
spätgotischen Seitenschiffe
war gerade. Er nutzte die Grundmauern der älteren
gotischen Kirche.
Der Fußboden des
1840
abgebrochenen spätgotischen
Langschiffes war ein vielfach
gestückelter Belag aus ziegelroten Tonplättchen niederrheinischer Art.
Darin eingelegt fanden sich zahlreiche Grabsteinplatten in Blaustein und
Sandstein. Sie lagen meist nicht mehr an ursprünglicher Stelle. Eine
ganze Anzahl hatte man auf die südliche Pfeilerfundamentbank der
älteren gotischen Kirche
gelegt, weil dort nicht weiter bestattet wurde.
-
4
Die Rekonstruktion der spätgotischen Kirche
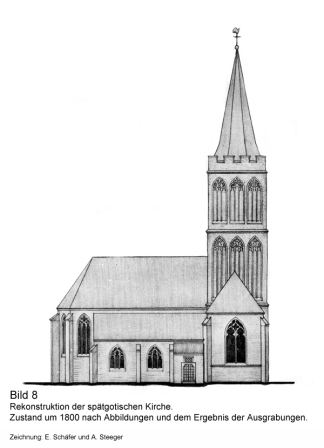
Unser
Wissen um den Bau der Alten Kirche lässt sich zusammenfassen:
-
Im 12. Jahrhundert er erbaute man in
Crinfelde dicht neben der Straßenkreuzung Fischeln - Hüls und
Kempen - Linn eine Dionysiuskapelle aus römischem Baumaterial. Wir
dürfen sie uns, auch in der geringen Größe, vorstellen wie den noch
erhaltenen Kernbau des St. -Peter-Kirchleins bei Kempen. Beide waren
einfache Saalkirchen mit Rundchor. So wie die Peterskapelle an einer
alten Straßenkreuzung und an der Grenze mehrerer Honnschaften
die Kirche für die ringsherum liegenden Bauernschaften Benrath,
Inrath, Dießem das gemeinsame Gotteshaus gewesen sein.
Vermutlich lagen auch in nächster Nähe der Kirche einige Bauernhöfe;
denn sie steht hart am Rande einer leichten Talung, die für
bäuerliche Siedler begehrenswertes Siedlungsland bot. Ähnliche
Saalkirchen bestanden
um 1200 in der Nachbarschaft
in Linn-Heulesheim (siehe
rekonstruierte Kirche von Archäologie in Krefeld),
Uerdingen und Fischeln. Vielleicht ist der von uns in
Krefeld festgestellte kleine
romanische Kapellenbau
aus Stein nicht einmal die älteste Kirche. Es ist durchaus möglich,
dass noch ein Holzbau vorangegangen ist.
-
Wie in Kempen
um 1300
die Peterskapelle nicht mehr genügte und man zum Neubau einer
größeren Kirche schritt, so wird sich auch in Krefeld in
dieser Zeit das Bedürfnis nach einem größeren Gotteshaus
herausgestellt haben. Man kann allerdings nur vermuten, dass der von
uns aufgefundene größere schon dreischiffige Bau der
älteren gotischen Kirche
mit einem gewissen Aufschwung des Ortes, der schließlich zur
Stadterhebung führte, zeitlich zusammenfällt.
-
Die
spätgotische Kirche
entstand in der am Niederrhein baulustigen und
schmuckfreudigen Zeit im letzten Drittel des
15. Jahrhunderts,
wie wir durch die inschriftenplatte am Turm und durch das
"Weihegefäß" wissen. Die ältere gotische Kirche wurde damals ganz
abgebrochen; von ihren Fundamenten wurden nur die der
Seitenschiffschlussmauern benutzt. Warum man den vergrößerten Neubau
einige Dezimeter nach Norden herausrückte, ist nicht ganz klar. Die
Rekonstruktion der
spätgotischen Anlage
(Bild 8),
die wir mit dem Architekten auf Grund der Bildunterlagen und der
Ausgrabungsergebnisse entwarfen. Der beherrschende Bauteil war, wie
bei so vielen niederrheinischen Dorfkirchen, ohne Zweifel der
Turm. Langhaus und Chor wirken demgegenüber viel
bescheidener. Ob man diese Verschiedenheit auf ein Erschöpfen der
Mittel zurückführen kann, mag dahingestellt bleiben, dass der
Kirchturm ein Symbol war, ein Ausdrucksmittel der Stärke, vielfach
sogar (vergl. Uerdingen!) ein echter Wehrturm. Daher dürfte
auch das Interesse des Landesherrn, des Grafen Vincentius von
Moers, an diesem Bau herrühren, der nach der Inschriftplatte
1472
den Grundstein legte
(Bild 4b). Nach unsern
Beobachtungen hat man den Turm und die beiden Turmhallen zusammen
mit dem Langschiff begonnen. Dasselbe hat auch H. Remkes
(Entwurf einer Chronik, um
1845)
beim Abbruch des gotischen
Langschiffs beobachtet. Dann
wäre es höchstwahrscheinlich, dass die
spätgotische Choranlage,
die sicher am dringlichsten war und die
romanische Apsis
ersetzen musste, zuerst begonnen wurde. Es ist nur eine ansprechende
Vermutung, wenn wir uns vorstellen, dass gegenüber dem am Turmbau
interessierten Landesherrn bei der Grundsteinlegung zum Chorhaus der
geistliche Herr, der Kölner Erzbischof, durch das
obengenannte "Weihegefäß" mit dem Kurkölner Kreuz
(Bild 7a), in Erscheinung
trat. Über das Innere der
spätgotischen Kirche sind wir
nur höchst mangelhaft unterrichtet. Die schweren achteckigen, aus
Ziegelstein gemauerten Pfeiler zeigten nur Vorlagen für die
Gurtbögen. Vermutlich setzten die Gewölberippen auf Konsolen auf.
Solche fanden wir wenigstens noch in den beiden Turmhallen vor.
Deutlich waren auch im Turm die Linien des alten Kreuzgewölbes zu
erkennen. Turm und Turmhallen bildeten einst eine wundervolle
Einheit. Sie waren durch hohe spitzbogige Arkadendurchbrüche
untereinander wie auch mit dem Langhaus verbunden. Die geplante
Öffnung und und Wiederherstellung der Arkaden hätte der Kirche eine
geschlossene, vor der ganzen Front herziehende Halle von besonderer
Schönheit geschenkt, man möchte fast sagen, beinahe eine Art
Westwerk gotischer
Prägung. Sie hatte in
spätgotischer Zeit am
Niederrhein kaum ein ebenbürtiges Gegenstück. Aber ihre
Schönheit war auch ihre Schwäche. Die großen Arkadendurchbrüche nach
allen vier Seiten machten den Turm zu einem sogenannten Pfeilerturm,
dessen gewaltige Last ganz allein auf den vier Pfeilern ruhte.
Leider können wir kein Rekonstruktionsbild dieser Halle vorlegen,
weil das Unglück uns überraschte und Einzelheiten des früheren
Zustandes noch nicht festgelegt waren. Alle, die um diese Dinge
wissen, sollten sich zusammentun, um wenigstens ein Bild nach der
Erinnerung zu schaffen.
-
1840
wurde das gotische Langhaus
mitsamt der Fundamente abgebrochen und an seiner Stelle die 1842
eingeweihte Kirche errichtet. Heute stehen von diesem Bau nur noch
Teile der Außenwände. Die Choranlage ist
1950
abgebrochen und durch eine erweiterte von rechteckiger Form ersetzt
worden
(Bild 6).
Das Innere der Kirche von
1842 mit vier Säulenpaaren,
drei gleich hohen Schiffen und eingebauter Empore zeigt uns
so deutlich, dass sich Worte der Erklärung erübrigen. - Die letzte
größere Veränderung an der Kirche vor der Zerstörung selbst wurde im
Jahre 1936
vorgenommen, als man das Turmportal beseitigte und die mittlere
Turmhalle zu einer Taufkapelle umgestaltete.

Die Alte Kirche von Krefeld Die Alte Kirche von Krefeld Die Alte Kirche von Krefeld Die Alte Kirche von Krefeld
Westansicht der Alten Kirche von 2011 Denkmal des Grafen Hermann von Neuenar-Moers Gedenktafel von 1747
Hör hier du Menschen Kind! mach dich zum Tod bereit
Geh durch die enge Pforte ins Reich der Seligkeit
Verlaß die schnöde Sünd die durch des Todes Jammer
Dich schlept elendig hin zur höllen glut und Jammer

Die Alte Kirche von Krefeld
Westansicht der Alten Kirche von 2011
|
|